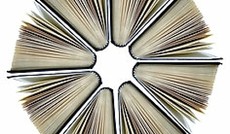
Digitale Bibliothek noch in den Kinderschuhen
Nach den Hörbüchern setzen sich nun auch die E-Books bei den Konsumenten zunehmend durch. Daher liegt es nahe, dass öffentliche Büchereien vermehrt die Möglichkeit der digitalen Entlehnung anbieten. Doch Angst der Rechteinhaber vor unlizenzierten Kopien, ungelöste rechtliche Fragen und finanzielle Schwierigkeiten behindern den Erfolg der Online-Dienste von Bibliotheken.
Unter Namen wie "Onleihe", "Digitale Stadt-Bibliothek" und "Bibliothek Digital" führen Österreichs Büchereien ihre digitalen Dienste. Die Bibliotheken wollen mit ihren Online-Diensten dem digitalen Zeitalter gerecht werden und den Kunden ermöglichen, E-Books, Hörbücher, Filme, Musik sowie elektronische Magazine und Zeitungen über das Internet ausleihen zu können.
Seit dem Frühjahr 2009 bieten die Büchereien der Städte Salzburg und Graz das von DiViBib in Deutschland entwickelte System "Onleihe" an. Die Wiener Büchereien planen, 2010 damit zu starten, auch die Stadt Linz trifft bereits die ersten Vorbereitungen dazu. In Innsbruck fehlt noch die Finanzierungszusage seitens der Politik, um damit starten zu können.
Kleine Gemeinden fallen durchs Netz
Die Möglichkeit, digitale Medien via Internet ausleihen zu können, ist auf den ersten Blick attraktiv. Doch gibt es auch zahlreiche Stolpersteine, beginnend beim mangelhaften Angebot, den Konditionen der Entlehnung, der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten durch digitales Rechtemanagement (DRM) und schließlich auch dem Zugangsproblem.
Den "Angelpunkt" sieht Gerald Leitner, Geschäftsführer des Büchereiverbands Österreichs (BVÖ), in der gesellschaftspolitischen Betrachtung des neuen Services. Mit der digitalen Bibliothek würde sich der "Standort auflösen" und auch Personen, die in abgeschiedenen Gegenden leben, ein einfacher Zugang zu einer Bücherei gewährt.
Hohe Kosten für Bibliotheken
Derzeit gebe es das Problem, dass nur Stadtbewohner Zugriff auf die digitalen Büchereien hätten. Diese seien jedoch bereits durch die physischen Bibliotheken gut versorgt, während Einwohner kleinerer Gemeinden wieder benachteiligt würden. "Damit potenziert sich das Zugangsproblem", so Leitner.
Das Problem sind die Kosten. Kleine Gemeinden werden sich die digitalen Bibliotheken nicht leisten können. Der BVÖ-Chef wünscht sich deshalb eine politische Lösung für ganz Österreich. Ein Zusammenschluss der Bibliotheken würde eine bessere Nutzung des Angebots österreichweit ermöglichen. "Bezüglich der Kosten gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Länder oder der Bund finanziert hier mit", so Leitner.
Wichtigster Anbieter für das digitale Bibliotheksverleihsystem im deutschsprachigen Raum ist die DiViBib GmbH mit ihrer "Onleihe". Derzeit steht den Vertragspartnern (Bibliotheken) ein Pool von 30.000 digitalen Medien zur Verfügung, aus dem die Inhalte gewählt werden können. Wie auch ihr Mutterunternehmen, die ekz.bibliotheksservice GmbH, ist die DiViBib in Deutschland ansässig. Die ekz steht wiederum im Eigentum von mehreren deutschen Städten, Bundesländern sowie Privatpersonen und betreibt als großer Ausstatter von Bibliotheken eine Zweigstelle in Österreich.
Wichtigster Anbieter ist DiViBib
"Es gibt nicht viele Anbieter im Bereich digitaler Bibliotheken", erklärt Leitner. Nach eigenen Angaben ist die in Deutschland ansässige DiViBib der "größte und einzige Anbieter digitaler Medien für öffentliche Bibliotheken im deutschsprachigen Raum", so DiViBib gegenüber ORF.at. Alle digitalen Bibliotheken der städtischen Büchereien in Österreich - bereits bestehende wie geplante - haben Verträge mit dem deutschen Unternehmen, das über die meisten Lizenzvereinbarungen mit Verlagen im deutschsprachigen Raum verfügen soll.
Derzeit verhandeln die städtischen Büchereien im Alleingang Verträge mit DiViBib aus. Dabei können die Bibliotheken das Angebot selbst zusammenstellen und auf "Gesamtpakete" zurückgreifen. Die Bücherei bestimmt also selbst, welche Titel von DiViBib abonniert werden.
E-Books beliebig oft herunterladen
Benutzer können sich dann in ihrem Accout auf der Homepage ihrer Bücherei einloggen und aus der "Onleihe" einen oder mehrere Titeln auswählen. Diese können danach entlehnt, das heißt auf den PC zuhause heruntergeladen und eine bestimmte Zeit lang genutzt werden. Physisch greifen hier die Nutzer eigentlich auf den Server von DiViBib zu, auf dem die elektronischen Medien gelagert sind.
Neben der Infrastruktur stellt DiViBib auch die Benutzerschnittstelle im Web zur Verfügung. Optionen wie Entlehnfristen und erlaubte Höchstmengen an gleichzeitig entliehenen digitalen Titeln pro Person werden von den Büchereien vorgegeben. So dürfen in Graz von einem Büchereinutzer bis zu 50 Titel auf einmal ausgeborgt werden, während in Salzburg nur zehn erlaubt sind. Videos, Musik und (Hör-)Bücher dürfen zwischen ein bis zwei Wochen entlehnt werden, während Magazine oft nur für einen Tag und Zeitungen nur stundenweise zur Verfügung stehen.
DRM schränkt Nutzung ein
Alle Medien sind mit einem digitalen Rechtemanagementsystem (DRM) versehen, das festlegt, was der Nutzer mit der jeweiligen Mediendatei tun darf. Auch wenn mit dem elektronischen Format eine Mehrfachnutzung einfach wäre, ist jedes E-Book und Hörbuch, wie auch physische Bücher und DVDs, nur als einzelnes "Exemplar" entlehnbar. Das heißt, dass es auch hier zu Wartezeiten kommt, wenn ein E-Book gerade von jemand anderen gelesen wird.
Das DRM regelt auch die Nutzungsdauer und die Vervielfältigung. Wird ein Titel entlehnt, dann ist er - je nach Bücherei - zwischen ein bis zwei Wochen nutzbar. In dieser Zeit lässt sich der Titel beliebig oft auf den eigenen PC herunterladen. Für die Nutzung eines E-Books etwa auf anderen digitalen Datenträgern, wie E-Reader, lässt sich ein Buch auf maximal sechs verschiedene Geräte kopieren.
Problem: Keine vorzeitige Rückgabe möglich
Läuft die Frist ab, lässt sich das E-Book oder der Film auf keinem Datenträger mehr nutzen. Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht möglich, was den Nachteil hat, dass auch andere Personen in dieser Zeit keinen Zugriff auf den Titel haben. Klaus Graf, Geschäftsführer des Hochschularchivs der RWTH Aachen und Mitautor des kritischen deutschen Bibliothekarsweblogs netbib, sieht darin eine "künstliche Verknappung", die zu persönlichen Einschränkungen führe.
"Hier wird alter Wein in neuen digitalen Schläuchen verkauft", kritisiert Graf die "Onleihe". Zum einen sehe er im DRM keinen sinnvollen Schutz, da es noch genug "analoge Lücken" gebe. Zum anderen würden damit auch die Nutzungsmöglichkeiten stark eingeschränkt werden. Auch für den Datenschutz sei diese Form der Kontrolle problematisch, da sämtliche Nutzungsdaten an einen DRM-Server übertragen würden.
Angebot enthält "viel Schrott"
Heftige Kritik übt Graf auch am derzeitigen Angebot der DiViBib, jedoch werde "auch ein schlechtes Angebot genutzt, wenn es dem Zeitgeist entspricht". Die Auswahl sei nicht umfangreich genug, zudem befinde sich "viel Schrott" darunter. Mit dem Angebot sind auch die österreichischen Büchereien nicht ganz zufrieden. So gebe es etwa im Bereich der Musik hauptsächlich nur Klassik und Jazz, wobei Popmusik, die für jüngere Menschen interessant wäre, kaum angeboten würde. Auch Hörbücher, die sehr gefragt seien, gebe es zu wenige.
"Lernhilfen haben wir überhaupt nicht im Programm, weil die Angebote auf den Markt in Deutschland abgestimmt sind", so Helmut Windinger, Leiter der Büchereien der Stadt Salzburg. Derzeit würden insgesamt 8.000 Titel angeboten. Die Erfahrungen bisher hätten gezeigt, dass der Umsatz (Entlehnung) eines digitalen Mediums in etwa dem eines physischen Buches entspricht. Für das erste Jahr erwartet sich Windinger in etwa 12.000 Entlehnungen über die "Onleihe".
"Digitale Entlehnung" kommt gut an
Auch die Grazer Bibliotheksleiterin Roswitha Schipfer zeigt sich optimistisch: "Die digitale Entlehnung hat sich nach einem guten Start sehr gut entwickelt." In den ersten Tagen habe es etwa 200 Downloads täglich gegeben, was für Graz sehr viel sei. Mittlerweile seien es durchschnittlich 2.000 Titel, die monatlich über den digitalen Service bestellt würden.
Die Grazer Stadtbibliothek bietet knapp 5.000 Bücher im elektronischen Format an. Hauptsächlich sind es Sachbücher wie Reiseführer, Sport- und Gesundheitsbücher sowie Lernhilfen, die angeboten würden. "Weniger Romane, weil wir der Meinung sind, dass die besser im Hörbuchbereich gehen", erklärt Schipfer. Sehr beliebt seien Filme, bei den E-Books seien die Ratgeber sehr gefragt. Was wohl auch am Angebot liegen mag, da noch sehr wenig Belletristik angeboten wird.
Lesegeräte in der Bibliothek
Die Büchereien Wien starteten Mitte September eine Kooperation gemeinsam mit dem E-Book-Hersteller Sony und der Buchhandelskette Thalia. In der Sony-E-Book-Lounge der Wiener Hauptbücherei auf dem Urban-Loritz-Platz können Interessierte E-Books ausprobieren. Für Kunden werden zehn E-Reader kostenlos zur Verfügung gestellt, die jedoch nur innerhalb der Räumlichkeiten der Bibliothek genutzt werden können.
Vier E-Reader sind an Konsolen festgemacht, mit den restlichen sechs Stück kann sich der Leser in der Bibliothek frei bewegen. Zu testen gibt es beide E-Book-Generationen von Sony, der PRS-505 sowie der PRS-600. Den Content für die Reader stellt Thalia gratis zur Verfügung. Derzeit sind etwa fünf Bestseller auf jedem Reader zu finden, pro Monat sollen drei weitere dazukommen.
Langwierige Verhandlungen über E-Book-Rechte
Die Wiener Bibliotheken werden bei der "Onleihe" auf die elektronischen Zeitungen und Zeitschriften völlig verzichten. "Weil hauptsächlich deutsche Produkte angeboten werden", begründet Christian Jahl, Leiter der Hauptbibliothek Wien. "Der Schwerpunkt geht zu Beginn in Richtung Sachbuch und alles was mit Lernen zusammenhängt." Als Beispiel nennt Jahl Schülerhilfen und Bewerbungsratgeber. "Wenn sich die Reader mehr durchsetzen, dann wird auch die Belletristik zunehmend interessanter."
"Ein Problem ist, dass die Nutzung von E-Books noch nicht ausjudiziert ist", erklärt Jahl. Bei den Hardcover-Büchern würden von den Bibliotheken für alle Ausleihen Tantiemen an die Verwertungsgesellschaft abgegeben, E-Books seien hier aber noch nicht berücksichtigt. Kernpunkt der Diskussion sei vor allem, ob elektronische Bücher auch unter die Preisbindung fallen sollen. Es sei damit zu rechnen, dass der Prozess noch ein bis zwei Jahre dauern werde.
Zu wenige E-Reader, zu wenige E-Books
Holger Behrens, Geschäftsführer von DiViBib, erklärt gegenüber ORF.at, warum es derzeit noch relativ wenige deutschsprachige und insbesondere österreichische Bücher in elektronischer Form gebe: "So wie wir mit den Verlagen die Rechte klären, müssen diese das auch mit ihren Autoren klären."
So müsse im Bereich des Urheberrechts sehr viel nachverhandelt werden. Zudem kämen auf die Verlage Investitionen für die Digitalisierung der Bücher sowie interne Strukturveränderungen zu. "Es ist das Henne-Ei-Problem: Weil es keine interessanten Inhalte gibt, verkaufen sich etwa Reader noch schlecht." Umgekehrt würden die Verlage mit den Investitionen abwarten, da es noch keinen großen Markt gebe, der nach digitaler Literatur verlange. In Kürze werde man zumindest einen großen österreichischen Verlag "an Bord haben", so Behrens.
Digital ist nicht billiger
Was die Kosten für die Einrichtung einer digitalen Bibliothek betrifft, so wollte keiner der Parteien konkrete Zahlen nennen. Aus Salzburg kam der Hinweis, dass ein digitales Medium nicht wesentlich günstiger als ein physisches sei. Das konnte auch die Bibliothek in Graz gegenüber ORF.at bestätigen.
(futurezone/Claudia Glechner)
