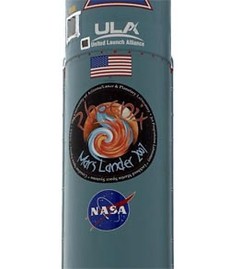
NASA-Roboter "Phoenix" fliegt zum Mars
Seit 11.26 Uhr MESZ ist mit "Phoenix" ein Bohr- und Schaufelroboter auf der riskanten Reise zum Mars. Gelingt die Landung, wird der mit einem strahlengehärteten Bordcomputer ausgestattete Lander drei Monate lang nach Wasser graben, um es dann auf Spuren von Lebensformen zu untersuchen.
Dreieinhalb Jahre sind die beiden Mars-Rover "Spirit" und "Opportunity" bereits auf dem Mars unterwegs. Trotz leichter Beschädigungen arbeiten beide Roboter immer noch fleißig und liefern ständig neue Bilder des Roten Planeten.
Am Samstag, 11.26 Uhr, ist nun der nächste NASA-Roboter, der Lander "Phoenix", ohne Probleme vom US-Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral auf die zehnmonatige Reise zum Mars gestartet.
Untersuchung des gefrorenen Ozeans
"Phoenix" soll in der Nähe des Mars-Nordpols landen und bei Temperaturen von minus 73 bis minus 33 Grad mit Hilfe eines Roboterarms erstmals das gefrorene Wasser unter der Oberfläche des Roten Planeten untersuchen.
"Die Sonde 'Phoenix' wird als Erste das Wasser des Mars berühren und analysieren", so Doug McCuistion, der die Marsprogramme der NASA leitet.
Erfolgsquote bei 50 Prozent
Die Mission zum Mars ist riskant, besonders die Landung ist wegen der widrigen Witterungsbedingungen und häufigen Stürme eine große Herausforderung. Seit 1988 haben die USA und andere Länder 14 Missionen in Richtung Mars gestartet. Die Hälfte davon schlug fehl.
Start um 11.26 Uhr live im Netz
Die Kosten für die unbemannte "Phoenix"-Mission belaufen sich auf 420 Millionen Dollar [300 Millionen Euro]. Der Start wurde live im Internet übertragen.
Der erdähnliche Planet Mars ist, von der Sonne aus gesehen, der vierte Planet in unserem Sonnensystem und der äußere Nachbar der Erde. Die Färbung des "rostigen" Planeten beruht auf Eisenoxidstaub auf der Oberfläche und in der Atmosphäre.
Bisherige Forschungen lassen den Schluss zu, dass der Mars früher von einem großen Ozean bedeckt war. 2005 fand die ESA-Sonde "Mars Express" ein Eisfeld mit 250 km Durchmesser.
Tückische Landung am 25. Mai 2008
Die fünf mal eineinhalb Meter große Sonde soll planmäßig am 25. Mai 2008 auf dem 400 Millionen Kilometer entfernten Mars aufsetzen.
Die kritische Phase des Abstiegs zur Marsoberfläche dauert etwa 13 Minuten. An einem Fallschirm soll die 670 Kilogramm schwere "Phoenix" zu Boden schweben. Kurz vor der Landung zünden zusätzlich Bremsraketen.
Roboterarm mit Schaufel und Kamera
15 Minuten nach der Landung soll der Roboter ein Sonnensegel für die Energieversorgung ausfahren. Ein 2,30 Meter langer Roboterarm mit einer Mini-Baggerschaufel an der Spitze sowie einer eingebauten Kamera wird dann bis zu einen Meter tief in den Boden bohren, bis er die verborgene Eisschicht erreicht.
Strahlengehärtete Prozessoren an Bord
"Phoenix" ist im Inneren mit einem gegen kosmische Strahlung geschützten RAD6000-Computer von BAE Systems ausgestattet, der auf der Power-Architektur von IBM basiert. Als zentrale Schaltstelle des Marsmobils wird der RAD6000 Navigationsdaten sowohl im All als auch auf der Marsoberfläche verarbeiten und Systeme der Sonde steuern.
Langes Leben für "Spirit" und "Opportunity"
Eigentlich hatte die NASA damit gerechnet, dass die 2004 gestarteten Sonden "Spirit" und "Opportunity" die harten Klimabedingungen auf dem Mars nicht allzu lange überleben, doch die beiden Roboterfahrzeuge erfreuen sich zumindest großteils bester Gesundheit.
Die zentralen Instrumente beider Fahrzeuge basieren ebenfalls auf einem Computersystem mit 32-Bit-Power-Architektur und dem strahlengehärteten Rechner vom Typ RAD6000.
Drei Monate Arbeitszeit
Auf dem Mars angekommen, bleiben dem Roboter während des Polarfrühlings und -sommers mit Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt drei Monate Zeit für die wissenschaftliche Forschung.
Danach reicht die Sonnenenergie nur noch aus, um jeden dritten oder vierten Tag zu arbeiten, bis das Gefährt schlussendlich in den Tiefschlaf fällt.
Suche nach Leben
Dabei soll der Roboter die Proben gleich vor Ort nach Spuren organischer Chemie wie etwa Kohlenstoff durchsuchen und damit unter anderem der Frage nachgehen, die Wissenschaftler schon lange fasziniert: Gibt oder gab es auf dem Nachbarplaneten der Erde Formen von Leben?
Die Instrumente an Bord sind so präzise, dass sie Objekte untersuchen können, deren Größe einem Tausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haars entspricht.
Vor-Ort-Analyse der Bodenproben
"Unsere Instrumente können untersuchen, ob die Polarregion primitiven Mikroben das Leben ermöglicht", erklärt der Wissenschaftler Peter Smith von der Universität Arizona. In einem eigenen Mini-Ofen im Lander wird die Probe erhitzt und dann auf ihre chemische Zusammensetzung analysiert.
Derzeit umkreisen insgesamt fünf Sonden den Nachbarplaneten, darunter auch der "Mars-Express" der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. "Mars-Express" sollte ursprünglich die Daten des europäischen Marsroboters "Beagle 2" übertragen, der bei der Landung auf dem Mars verloren ging.
Bemannte Mission vorbereiten
"Phoenix" ist aber nicht nur auf der Spur von möglichem Leben. Die Wissenschaftler erhoffen sich auch weitere Erkenntnisse über den Klimawandel - warum aus dem einst feuchten und warmen Mars ein kalter Planet mit vereisten Polarkappen wurde.
Und schließlich hat die NASA noch ein langfristiges Ziel im Auge. Irgendwann in einer Zeit nach 2020 sollen sechs Astronauten zum Nachbarplaneten fliegen. Gesucht wird noch ein Landeplatz samt Wasservorrat.
Eiswolken im Mars-Frühling
Am Ende der Mission soll "Phoenix" außerdem Zeuge eines spektakulären Klimaphänomens werden: Jedes Jahr während des Mars-Frühlings verdampfen am Mars-Pol große Mengen Kohlendioxideis und bilden Eiswolken.
Die Sonde soll Zusammensetzung, Bestandsdauer und Bewegung dieser Wolken untersuchen.
Weitere Marsmissionen
In den nächsten Jahren sollen gleich zwei weitere große Rover-Missionen zum Mars fliegen: 2009 das "Mars Science Laboratory" der NASA für geologische Untersuchungen und 2013 "ExoMars" der europäischen ESA zur Suche nach Spuren von Leben.
(Reuters | dpa | NASA)
