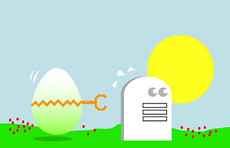
Die Suche nach findigen Robotern
Während die Suche nach Ostereiern als Spiel für kleine Kinder gilt, ist es längst nicht so einfach, einem Roboter das Suchen, Finden und Erkennen von Gegenständen beizubringen. ORF.at sprach mit dem Wiener Robotik-Experten Peter Kopacek über den Stand der Technik.
Peter Kopacek ist Professor an der TU Wien und Leiter deren Instituts für Handhabungsgeräte und Robotertechnik [IHRT]. Er ist unter anderem Träger des "Robotik-Nobelpreises" Engelberger Robotics Award und hat als Trainer seiner TU-Fußballrobotermannschaft mehrere Welt- und Europameistertitel der Federation of International Robot-Soccer Association [FIRA] nach Hause bringen können.
ORF.at: Herr Kopacek, eigentlich sind wir Menschen ja ständig am Suchen, speziell zu Ostern. Gibt es schon Roboter, die Ostereier suchen und finden können?
Kopacek: Ja. Aber es hängt von vielen verschiedenen Aspekten ab, wie lange er dazu braucht. Beispielsweise davon, wie groß der Garten ist, in dem die Ostereier versteckt sind, und wie viel der Roboter von dem Garten weiß.
Wenn Sie ihm einfach ein Ei hinhalten, dann wird er sich das merken und so lange im Garten herumfahren, bis er eines findet. Beim Suchen ohne weitere Hilfe entspricht die Leistung der allermeisten mobilen Roboter jener eines ein- oder zweijährigen Kindes. Die besten heute verfügbaren Maschinen schaffen es auf das Niveau eines Acht- oder Zehnjährigen.
ORF.at: Wie suchen Roboter?
Kopacek: Mit verschiedenen Sensoren. Heute ist das vor allem eine Angelegenheit der Bildverarbeitung und Bildauswertung. Im FZI Karlsruhe arbeitet man schon seit mehreren Jahren an dem Roboter ARMAR, der heute schon so gut ist, dass man ihm ein Buch zeigen kann und er es mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit wiedererkennen wird, wenn er es irgendwo liegen sieht.
Die Sensoren werden auch immer besser. Im Roboterfußball haben wir 1998 noch mit Kameras gearbeitet, die 30 Bilder pro Sekunde geliefert haben. Heute haben wir eine Digitalkamera, die 200 Bilder pro Sekunde schafft und nur 1.000 Euro kostet. Andere Teams arbeiten schon mit Kameras, die 500 Bilder pro Sekunde liefern können, dann aber 12.000 Euro kosten. Die Rechenleistung muss da natürlich mithalten können, aber die CPUs werden auch immer leistungsfähiger und günstiger, ebenso wie die Methoden der künstlichen Intelligenz.
ORF.at: Kann man wirklich schon von "künstlicher Intelligenz" sprechen?
Kopacek: Die KI-Pakete, die mir bekannt sind, interpolieren nur zwischen zwei Problemlösungen, um auf die Lösung eines ihnen unbekannten Problems zu kommen. Sie werden dann in der Regel drei oder vier Lösungsvorschläge liefern, die dann aber immer noch ein Mensch bewerten muss.
ORF.at: Ein Roboter kann nicht nur mit optischen Sensoren suchen. Sie haben auch einen Minensuchroboter gebaut, der Gegenstände finden muss, die unter der Erde versteckt sind.
Kopacek: Unser Minensuchroboter "Humi" verwendet dazu einfache Metalldetektoren österreichischer Provenienz, mit denen er es immerhin schafft, eine Menge von 1,5 Gramm Metall in bis zu zehn Zentimeter Tiefe zu orten. Es gibt nun aber auch Landminen, in denen überhaupt kein Metall mehr steckt.
Der in den Minen verwendete Sprengstoff TNT hat aber einen sehr speziellen Geruch, also könnte man Geruchssensoren einsetzen, um diese metallfreien Minen aufzuspüren. Diese Sensoren müssen aber erst noch entwickelt werden. Eine andere interessante Aufgabe besteht darin, den Robotern gutes räumliches Hören beizubringen.
Minensuchroboter "Humi" vor einer Präsentation im Jänner 2008.
ORF.at: Selbstfahrende Roboter wie Humi, stationäre Industrieroboter oder einfache Haushaltsgeräte wie der Staubsaugroboter, der selbsttätig den Teppichboden abfährt und reinigt, gehören ja schon länger zu unserer Umgebung. Was ist aber mit den humanoiden Robotern?
Kopacek: Spätestens seit Karel Capeks Theaterstück "R.U.R." von 1921 träumen die Menschen von intelligenten Maschinen, die so ähnlich aussehen wie sie selbst. Mein Problem mit diesen humanoiden Robotern ist, dass es derzeit noch keine zwingende industrielle Anwendung für sie gibt.
In Asien geben Hightech-Firmen sehr viel Geld für die Entwicklung humanoider Roboter aus. Ich vermute, denen hat ein Marketing-Guru weisgemacht, dass die Hochtechnologie-Anmutung der Roboter auf die banaleren Produkte dieser Firmen abfärbt.
Andererseits kann es sinnvoll sein, einen Roboter zu bauen, der auf zwei Beinen stehen und laufen kann wie ein Mensch. Wir bauen jetzt selbst einen Zweibeiner mit dem Namen "Archie". Wenn ich emeritiert bin, wird "Archie" bei mir auf dem Sofa sitzen und mit mir Fußball gucken. Leider bin ich Austria-Anhänger.
ORF.at: Wäre so ein Zweibeiner besser als ein Roboter mit Rädern?
Kopacek: "Archie" soll speziell in unebenem Gelände gut zurechtkommen. Er soll 2009 fertig sein. Die Szene ist allerdings derzeit sehr stark in Bewegung. Ein Beispiel: Wir brauchen für "Archies" Gelenke einen speziellen Sensor, der die Kräfte und Momente misst, die auf seine Fußsohle wirken, damit er seine Balance daraus berechnen kann.
Ein solcher Sensor ist acht mal acht mal acht Zentimeter groß und kostet derzeit 6.000 US-Dollar pro Stück. Es läuft aber bereits ein EU-Projekt, in dessen Rahmen bis 2010 ein Sensor entwickelt werden soll, der das Gleiche leistet, nur noch fünf mal fünf mal einen Millimeter misst und zwölf Euro pro Stück kosten wird. Die Entwicklung geht sehr schnell. In Japan denkt man schon an die Konstruktion von Robotern im Femto-Bereich. Da sind wir schon bald im Maßstab des Atomgitters.
ORF.at: Um nochmals aufs Thema Suchen zurückzukommen: Viele Konsumenten suchen schon seit langem nach dem bezahlbaren universellen Haushaltsroboter. Werden wir den jemals im Laden kaufen können?
Kopacek: Die werden sicher kommen. In spätestens zehn Jahren. Das Problem ist nach wie vor der Preis. In Korea gibt es derzeit ungefähr 20 Firmen, die an der Herstellung immer komplizierter werdender Spielzeugroboter arbeiten. Noch sind die recht simpel und kosten zwischen 800 und 1.000 US-Dollar. Den Roboterhund AIBO von Sony habe ich im Ausverkauf für 799 Euro gesehen.
Am Anfang ist so ein Roboter nur ein Produkt für Freaks. Am Ende soll er aber so leistungsfähig und bedienungsfreundlich sein, dass der Käufer ihn nur noch einzuschalten braucht. Oft ist es aber so, dass Menschen einfach besser und billiger sind. Das merken wir auch bei unserem Minensuchroboter.
In Mosambik verlangt ein erfahrener Minensucher im Monat 150 US-Dollar. Beim "Humi" belaufen sich die Materialkosten allein auf 8.000 Euro. Damit er bezahlbar wird, müssen wir ihn professionell vermarkten und in Serie herstellen. Am Ende wird er mit GPS-Modul wohl zwischen 12.000 und 15.000 Euro kosten.
(futurezone | Günter Hack)
