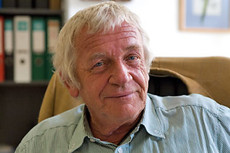
Peter Kopacek: Ein Herz für Roboter
Am 30. September emeritiert der österreichische Robotik-Pionier Peter Kopacek. Kopacek ist Gründungsprofessor des Instituts für Handhabungsgeräte und Robotertechnik [IHRT] der TU Wien. Sein neuestes Projekt ist der Bau eines zweibeinigen Roboters, der Menschen im Alltag unterstützen soll. ORF.at sprach mit ihm über seine Zukunftspläne.
In der Öffentlichkeit treten Kopacek und sein Team oft durch ihre zahlreichen Erfolge im Roboterfußball in Erscheinung. Sie konnten für Österreich mehrere Welt- und Europameistertitel der Federation of International Robot-Soccer Association [FIRA] nach Hause bringen.
In der Fachwelt hat sich der gebürtige Wiener, der im Oktober seinen 69. Geburtstag feiert, im Lauf seiner Tätigkeit großes Ansehen erworben. Er ist unter anderem Träger des "Robotik-Nobelpreises" Engelberger Robotics Award.
Peter Kopacek in seinem Büro an der TU Wien
ORF.at: Sie beschäftigen sich schon Ihr ganzes Berufsleben lang mit Automatisierung und Robotik. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Peter Kopacek: Das begann rein zufällig. Ich war im Maschinenbau der erste Wahnsinnige, der eine Diplomarbeit auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik geschrieben hat. Seitdem bin ich bei der Stange geblieben und habe über Automatisierungstheorie gearbeitet und auf diesem Gebiet promoviert und habilitiert.
Das war in den 1960er und 1970er Jahren.
Ich habe mich mit einem Fachgebiet beschäftigt, das damals in Österreich noch recht unbekannt war, und bin dann sukzessive in die Robotik hineingeraten. Das war dadurch bedingt, dass ich Konsulent bei einer ehemals namhaften österreichischen Firma war, der Eumig. Da begannen wir 1977 mit der Entwicklung von Montageautomaten mit den ersten Mikroprozessorsteuerungen, die es damals gab. Das war der Einstieg in die Produktionsautomatisierung und Robotertechnik.
Ab wann gab es dann Robotik im Lehrangebot?
Gemeinsam mit Kurt Desoyer [Mechanik] und Inge Troch [Mathematik] habe ich dann an der TU Wien im Wintersemester 1982/83 das erste Seminar über Robotik angeboten, und 1985 haben wir eines der ersten Bücher im deutschsprachigen Raum über Robotertechnik abgeschlossen. Im Studienjahr 1983/84 gab es dann die ersten regelmäßigen Lehrveranstaltungen an der TU Wien über Robotertechnik. Dabei handelte es sich zuerst nur um eine Vorlesung, die Übungen dazu gab es erst später.
Ich wurde ja dann auf einen Lehrstuhl für Systemtechnik an der Johannes-Kepler-Universität Linz berufen. 1990 richtete die TU Wien ein Institut für Robotertechnik ein und holte mich zurück. Seitdem beschäftige ich mich mit diesem relativ eigenartigen Fachgebiet. Meine Karriere hier an der TU Wien begann 1990 in zwei geliehenen Räumen des Instituts für Mechanik von Kurt Desoyer - einer mit Fenster, einer ohne Fenster. Den ohne Fenster haben wir immer als "Sonnenstudio" bezeichnet. Und durch fünfmaliges Umziehen hat mir irgendeine ministerielle Glücksfee zum 60. Geburtstag diese Institutsräume beschert.
Mit welchen Themen haben Sie sich damals auseinandergesetzt?
Wir haben seinerzeit mit klassischer Robotertechnik begonnen. Mit Industrierobotern, Kinematik, Dynamik, was man so allgemein macht. Ich habe dieses Gebiet der Industrieroboter aber vor zirka 15 Jahren verlassen und habe versucht, mich der sogenannten modernen Robotertechnik zu widmen, also mobilen und intelligenten Robotern. Wir waren, glaube ich, auch die Ersten, die 1997/98 eigenartige Vorträge über Roboter in der Medizin gehalten haben.
Ich habe in meinem Universitätsleben außerdem gelernt, dass das Zeitalter des Wissenschaftlers mit langem weißem Rauschebart, der ein Jahr lang über einer neuen Publikation brütet und dann vor die staunende Fachwelt tritt, eigentlich vorbei ist. Das hat schon bei meiner Tätigkeit in Linz begonnen. Public Relations, Marketing, das Institut als Dienstleistungsbüro für Studenten.
Inwieweit unterscheiden sich Roboter eigentlich von anderen Maschinen?
Für die Industrieroboter, die ich ätzenderweise als Nilpferdroboter bezeichne, gibt es schon eine Definition. Aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo die intelligente Maschine oder das Pick-'n'-Place-Gerät aufhört und der Roboter anfängt. Da gibt es noch Meinungsunterschiede in der Fachwelt. Wenn man sich jetzt von den Industrierobotern loslöst und mobile und humanoide Roboter betrachtet, dann sind die eigentlich auch nichts anderes als intelligente Maschinen.
Dazu kommt, dass es viele Operatoren gibt, die ganz einfach ferngesteuert und so für gefährliche Aufgaben verwendet werden. Das sind alles Teleoperatoren, und man dürfte sie eigentlich nicht als Roboter bezeichnen.
Ein Roboter ist also mehr als einfach nur eine hochentwickelte Maschine.
Unter einem mobilen intelligenten Roboter verstehe ich ein Gerät mit Füßen, mit Ketten, mit Rädern, mit Flügeln oder mit Schwimmflossen, das wirklich völlig autonom agiert und so viel Intelligenz hat, dass es sich seinen Weg sucht und seine Aufgaben selbsttätig plant.
Intelligenz, wie wir sie als Menschen verstehen, kann sich offenbar nur im Zusammenspiel mit Körpererfahrung entwickeln. Haben wir mit Robotern eine größere Chance zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz als Computer alleine?
Es begann ja mit der Mechatronik, und der Roboter ist ein Beispiel für ein mechatronisches System. Man braucht Maschinenbau, man braucht Elektrotechnik, man braucht die Informatik für die Software. Roboter sind heute auch eine Plattform, auf der sich KI-Forscher und Neurowissenschaftler austoben können. Die meisten Roboter, die in den Forschungslabors stehen, kann man vom Standpunkt des Maschinenbauers her vergessen. Die dienen nur dazu, irgendwelche tollen Software-Pakete der künstlichen Intelligenz in der Praxis zu testen.
Wenn ein Computerfreak eine Freundin hat, und er sitzt nächtelang vor seiner Kiste, und die Freundin fragt ihn dann in der Früh, was er gemacht hat, dann kann er ihr schlecht ein Programm zeigen. Wenn er natürlich sagt: "Ich habe diesem süßen kleinen Roboter beigebracht, dass er einen Kaffee kocht", dann ist das was, was man begreift und gut findet. Der Roboter ist derzeit eine Spielwiese für die Anwendung irgendwelcher Theorien, seien es Anti-Kollisionsalgorithmen, sei es intelligente Bahnplanung, sei es Sprechen, Sehen, Fühlen.
Menschen können zu Geräten durchaus emotionale Beziehungen aufbauen wie zu Tieren. Passiert Ihnen das auch?
Seit 1921, als ein gewisser Herr Capek sein Stück "Rossum's Universal Robots" geschrieben hat, träumt Otto Normalverbraucher, wenn er den Begriff Roboter hört, von irgendeinem Klapperatismus, der genauso aussieht wie er, mit dem er sich unterhalten kann, der ihn unterstützt. Und auf diesem Weg sind wir jetzt. Sie wissen ja, eines meiner Hobbys ist der Roboterfußball, und wir haben die Meisterschaft Euroby 2008 mitveranstaltet.
Da habe ich zu meinen internationalen Kollegen ketzerisch gesagt: Liebe Leute, mit unseren zweirädrigen Robotern sind wir am Plafond der Forschung angelangt. Wir können jetzt Mannjahre in die Weiterentwicklung dieser Mirosot- und Narosot-Roboter stecken, aber es wird nicht mehr viel bringen. Wir können statt mit 30 mit 50 Stundenkilometern fahren und auf einem Spielfeld von fünf mal zehn Metern mit vier Kameras spielen, aber das wird kein echter Fortschritt sein.
Die Zukunft liegt in den Zweibeinern. Da schreitet die Entwicklung ganz rasant voran. Ich bin vor drei Jahren als einer der wenigen in der Branche auf die Idee gekommen, eine Vorlesung über humanoide Roboter anzubieten. Es ist schwierig, sie auf dem neuesten Stand zu halten. Die Entwicklung auf diesem Gebiet ist derzeit rasant und für den Einzelnen unüberschaubar. Trotzdem werde ich mich jetzt dann in Ruhe auf die Entwicklung meiner menschenähnlichen Roboter konzentrieren.
Ihr neues Hobby?
Ich werde in Ruhe weiterarbeiten auf dem Gebiet der Robotertechnik.
Sie sind auch sehr stark in Osteuropa engagiert.
Ich bin eigentlich schon seit 1969, 1970 in Osteuropa tätig. Da gab es ein nettes Programm namens WTZ - Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit. Das westlichste Land dabei war Finnland. Daher kommt es, dass ich schon in den 70er Jahren in Bulgarien, in Rumänien, in der ehemaligen DDR, Tschechien, Ungarn herumgekommen bin. Dass ich jetzt im Kosovo zu tun habe, kam daher, dass ich drei graduierte Doktoren habe, die Kosovaren sind.
Einer arbeitet heute in Niederösterreich bei einer Firma, der zweite ist Professor an der Universität Prishtina, mit dem dritten haben wir 2002 begonnen, die University for Business and Technology in Prishtina aufzubauen, eine Privatuniversität. Dort bin ich auch ab und zu tätig.
Die anderen Ostkontakte gehen noch auf die späten 1960er Jahre zurück. Wir waren ja die Ersten, die trotz Embargos einen IBM XT in die DDR importiert haben. In Ilmenau habe ich immer einen Leih-Trabi bekommen von den Kollegen. Damit durfte ich nach Weimar fahren und nach Erfurt und auf die Wartburg.
Was haben Sie aus diesen Beziehungen mitgenommen?
Die Kollegen aus dem Osten waren teilweise sehr gute Theoretiker. Das war für uns eine ganz gute Ergänzung, denn wir haben damals kaum Zeit für die theoretische Arbeit gehabt. Wir mussten eher realisieren. Heute fahre ich gern in Entwicklungsländer. Ich war kürzlich in Kurdistan. In Erbil, in Sulaimaniyya und in Kirkuk. Sehr zum Missfallen unseres österreichischen Botschafters in Amman, aber gut.
Was interessiert Sie daran? Das Aufbauen? Sind Sie deshalb kein Informatiker und bauen Roboter, anstatt Computer zu programmieren?
Ja. Mir macht es Spaß. Man könnte es natürlich so sagen: Der Kopacek wird nie ein Ehrendoktorat von Stanford oder vom MIT bekommen, weil er nicht theoretisch orientiert ist. Aber ich habe jetzt vier Ehrendoktorate, bin Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, was mich unheimlich freut.
Ich habe auch den Engelberger Award bekommen, eine der höchsten Auszeichnungen auf dem Gebiet der Robotertechnik. Das ist aber nur eine Alterserscheinung. Nein, an deutschen Universitäten will ich nicht herumgeistern, das sind ausgefahrene Geleise. Wenn man im Kosovo das erste Mechatroniklabor aufbaut und wenn man für die Universität Iskan in Sulaimaniyya einen Studienplan für Mechatronics-Management erstellt, dann ist das irrsinnig reizvoll.
Wie erleben Sie das Vordringen der Roboter in die Gesellschaft?
Das sind Diskussionen, die ich zusammen mit meinem lieben Herrn Kollegen Fleissner in den 80er Jahren mit Gewerkschaftern und der Industriellenvereinigung geführt habe. "Die menschenleere Fabrik" und so weiter.
Mein Statement dazu war immer: Man muss mit der Automatisierungstechnik leben. Und ein Roboter ist eigentlich immer nur dazu da, seinen Menschen zu unterstützen. Das versuchen wir jetzt mit unserem humanoiden Roboter zu realisieren.
Der soll aber nicht nur in der Fabrik arbeiten, sondern auch zu Hause.
Zurzeit kommt eine neue Generation von Spielzeugrobotern auf. Ich habe mir aus Korea einen Bausatz für einen humanoiden Roboter kommen lassen. Ich habe gedacht, der kann nichts. Man kann sich halt damit spielen. Andererseits ist das aber ein unheimlich großer Markt, der sich da auftut. Die Roboter sind nur noch zu teuer.
Mit dem Beginner-Kit, der in diesem Fall 300 US-Dollar gekostet hat, kann man noch wenig anfangen. Es gibt Kollegen, die sich solche billigen Roboter kaufen und dann versuchen, auf ihnen ganz tolle Software zu implementieren. Das finde ich nicht zielführend, weil Software mit unzulänglicher Hardware auch nichts bringt.
Diese Toy-Robots aus Asien sind noch relativ klein, aber sie sind jetzt schon wesentlich weiter als die ersten Spielzeugroboter von vor 20 Jahren. Wir wollen einen Roboter entwickeln, der zwischen Spielzeug- und Amateurklasse anzusiedeln ist. Er soll bezahlbar sein und eine vernünftige Größe haben, also einen Meter zehn, damit er auf den Tisch hinaufgreifen kann.
Einen Roboter, der die Menschen beim täglichen Leben unterstützt, also nicht nur im Haushalt oder beim Pingpong-Spielen und nicht nur zum Einkaufengehen, sondern auch am Arbeitsplatz. Das ist unser Ziel. Ob ich das jemals erreichen werde, weiß ich nicht.
Das Gegenmodell zum intelligenten Roboter ist der Schwarm aus vielen "dummen" Maschinen, die sich aber klug koordinieren.
Das nennt man dann mobile kooperative intelligente Roboter. Die offizielle Abkürzung ist MAS - Multi-Agent-Systems. Die Informatiker nennen es Robot-Swarms. Das ist natürlich auch eine Option für die Zukunft. Wenn man heute 20 Roboter in einer Werkshalle hat, muss man jeden einzeln programmieren. In Zukunft sollen die selbsttätig darauf achten, dass sie sich nicht in die Quere kommen.
Die Entwicklung scheint sehr schnell voranzuschreiten.
Es ist nur mehr eine Frage, was uns an Hardware zur Verfügung steht. Wenn wir derzeit einen Forschungsantrag zum Bau eines humanoiden Roboters stellen, dann können wir immer nur schreiben: nach dem derzeitigen Stand der Technologie und der abzuschätzenden Weiterentwicklung. Sie müssen rechnen, die Entwicklungszeit eines humanoiden Roboters beträgt ungefähr 20 Mannjahre, also arbeiten sechs Leute ungefähr drei Jahre lang daran. In den drei Jahren, in denen der Roboter fertig ist, ist er vom technologischen Standpunkt her schon Schnee von gestern. Das ist genau so, wie wenn sie sich einen PC kaufen und der schon Schrott wäre, bis sie ihn installiert und betriebsbereit haben.
Können Universitäten da noch mithalten?
Ich habe immer versucht, die größten Löcher im Forschungsemmentaler zu finden. Ich habe mich immer gefragt: Was macht niemand? Als österreichischer Universitätsschlumpf muss man mindestens zwei Ideen im Jahr haben. Die letzte Idee war das End-of-Life-Management für Roboter. Darauf ist noch niemand gekommen. Wir haben jetzt in der EU diese WEEE-Verordnung. Man müsste sich eigentlich Gedanken darüber machen, wie man nach dieser Richtlinie einen Roboter zerlegt am Ende seiner Lebenszeit.
Ein Wiener Roboterbegräbnis mit Pompfüneberer auf dem Zentralfriedhof ...
Naaa!
Roboter, die andere Roboter entsorgen ...
Könnte man sich auch vorstellen, ja.
Die Demontage ist ja schon seit längerem ein Forschungsschwerpunkt an Ihrem Institut.
Ja, das machen wir schon seit 1996. Da waren wir auch die Ersten weltweit. Wir sind mit dem Thema Disassembly auf internationalen Tagungen herumgegeistert. Wir waren zum Beispiel in Bukarest auf einer Tagung über Handys. Da kommt ein alter Kollege zu mir und sagt: Was du immer hast mit deinem Disassembly. Bei uns schmeißt du das Handy in den Mistkübel, das kommt auf die Deponie, danach holen es die Leute ab, und am nächsten Tag kannst du es auf einem Flohmarkt für fünf Euro wieder kaufen.
Einer meiner Mitarbeiter war 1997 an der Universitat Politecnica de Catalunya in Barcelona. Da mussten die Gastwissenschaftler immer Vorträge darüber halten, womit sie sich gerade beschäftigen. Und der hat einen Vortrag gehalten über die Zerlegung von Kühlschränken und so weiter. Die haben den ganz groß angeschaut: Kühlschrank? In der Nacht in den Kofferraum, über die Klippe und hinunter ins Meer.
Dafür sind Roboter sicher zu schade. Wir kann man sich das Ende eines Roboters vorstellen?
Zurzeit machen wir das noch händisch. Es sind ja sehr viele Teile, die man wiederverwenden kann. Es klingt skurril, aber in älteren Handys sind noch Torx-Schrauben verbaut. Die haben einen Durchmesser von 1,25 mm. Die Norm liegt bei 1,5 mm.
Versuchen Sie einmal, in Wien eine Schraube mit 1,25 mm Durchmesser aufzutreiben. Das ist erstens schwierig, und zweitens kostet eine Schraube dann 70 Cent oder einen Euro. Wir verkaufen unsere gebrauchten Schrauben für 20 Cent. Wir arbeiten nach dem Motto: Was kann man wiederverwerten? Das läuft unter der Überschrift "Minimierung des Elektronikschrotts".
Energie ist ja zurzeit das große Thema. Auch in der Robotik?
Das ist derzeit ein noch nicht gelöstes Problem bei allen mobilen Robotern. Sie müssen rechnen: 30 Prozent des Gewichts eines mobilen Roboters machen die Batterien aus. Dadurch haben die alle eine beschränkte Betriebszeit. Eineinhalb, zwei Stunden. Maximal.
Man könnte sich jetzt natürlich Sporen verdienen, indem man schaut, wie man von den Batterien wegkommt. In der Diskussion sind Brennstoffzellen und Solaranlagen und so weiter. Das sind klassische Probleme, die in der Robotik noch nicht gelöst sind.
Was ist eigentlich Ihr Lieblingsroboter?
Ich liebe alle meine Fußballroboter. Ich werde nie bei diesen in den USA so beliebten Roboterwettkämpfen mitmachen, bei denen sich Roboter zersägen und so weiter. Das ist da irrsinnig beliebt.
Mein Lieblingsroboter, falls er je fertig wird, ist der Archie, mein Zweibeiner. Das wird dann vielleicht irgendwann in der Rente mein Personal Robot.
(futurezone | Günter Hack)
